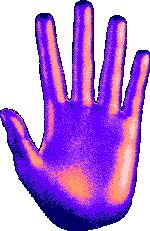Was wäre, wenn künftige Historiker unsere Kultur und Geschichte ohne Fotografien, Videofilme oder digitale Schriftaufzeichnungen rekonstruieren müssten? – Angesichts der schleichenden Auflösungsprozesse von Bild- oder Trägermaterial bei analogen Fotografien und der schnell veraltenden Wiedergabetechnologien von elektronischen Medien ist dieses Szenario wahrscheinlicher als manche von uns wahrhaben möchten. In nahezu allen Museen, Archiven, Bibliotheken und Sammlungen dieser Welt werden Spezialistinnen und Spezialisten benötigt, die mit verlässlichen Strategien diesem drohenden Verlust immenser Bestände vorbeugen.
Es existieren Tausende von Regalkilometern mit Magnetbändern, Filmdosen, Fotosammlungen und Tonträgern in vielfältigen Formen und Materialien, die aufgehoben, geschützt und digital zugreifbar gemacht werden müssen. Hinzu kommen komplexe Kunstwerke, die mitunter aus mehreren Medien bestehen und die in sich erhalten und erfahrbar bleiben müssen. Längst bilden auch die Speicher für digitale Daten selbst eine gänzlich neue Kategorie von Archivalien. Keine Sammlung, die nicht oder noch immer vor der großen Aufgabe steht, dieses Gedächtnis für die Zukunft zu erhalten oder in neue Formen zu wandeln. Um diese Kulturgüter für kommende Generationen lesbar, sichtbar und hörbar zu machen, braucht es ein umfangreiches Wissen um die verschiedenen vergangenen und aktuellen Verfahren, und eine hohe Kompetenz zur Übersetzung und Erhaltung in ein zukunftsträchtiges repräsentatives Digitalisat.
Der Masterstudiengang „Konservierung und Restaurierung Neuer Medien und Digitaler Information” begreift diese Aufgabe auf drei Ebenen. Einerseits sollen die Kulturobjekte im Sinne der präventiven Konservierung so lange wie möglich erhalten bleiben. Das bedeutet, die Materialien der Medien identifizieren zu können, ihre individuellen Lagerungsbedingungen zu kennen und über geeignete konservatorische Maßnahmen vor allem in Bezug auf das Klima im Depot für eine möglichst lange Haltbarkeit zu sorgen. Eine minimal invasive Restaurierung unterstützt die präventive Konservierung.
Weitere Informationen zum Studiengang unter www.abk-stuttgart.de